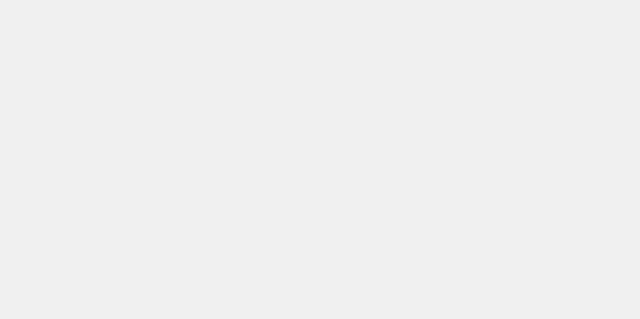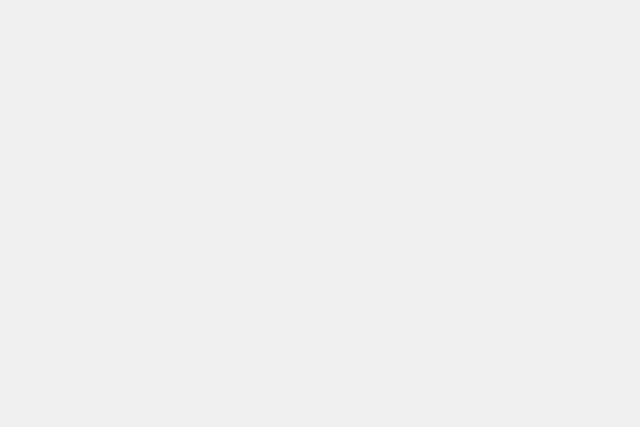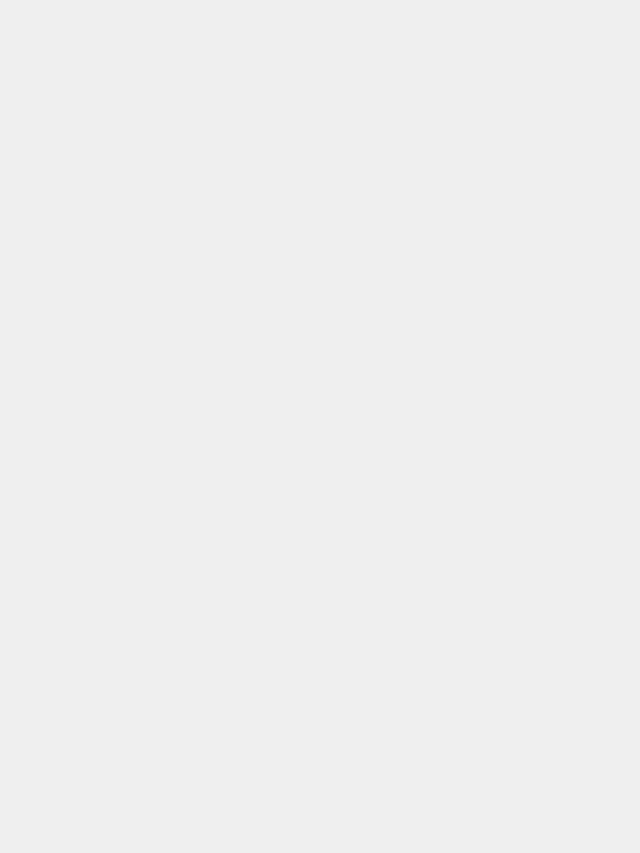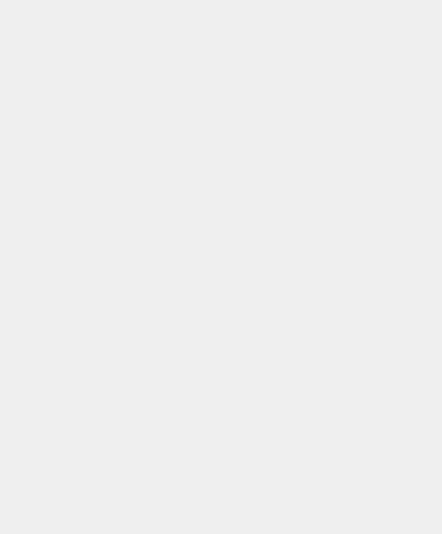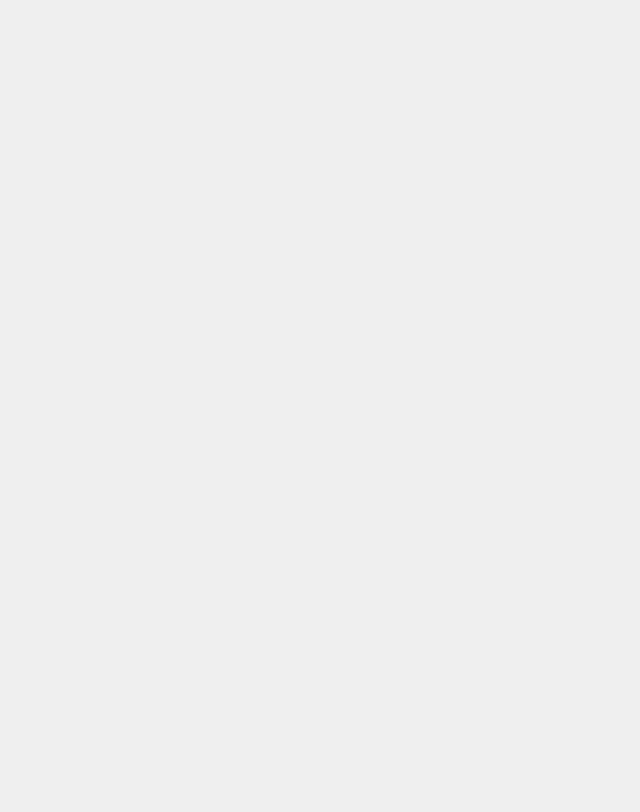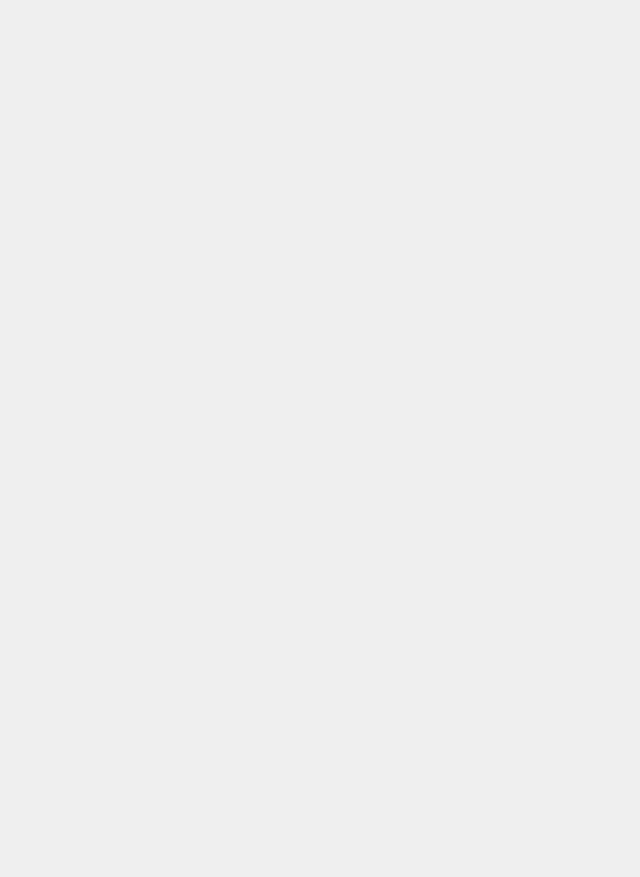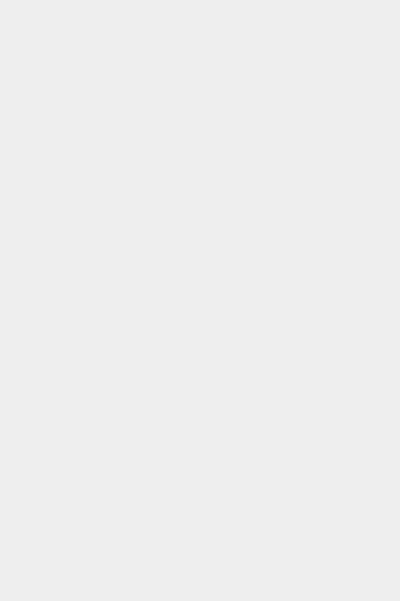vom 10. Mai bis 9. November 2025
Die neue Sonderausstellung „gewisper – gerüchte – geschreӱ. Wirtshaus und Bauernkrieg 1525“ des Südtiroler Landesmuseums für Volkskunde, in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Bruneck, macht diese unruhige, aber faszinierende Zeit mit ihren Spannungen und Veränderungen sicht- und hörbar. Und das an einem lebendigen Ort: nicht auf einem Schlachtfeld, sondern im Wirtshaus, einem seit jeher wichtigen Treffpunkt aller sozialen Schichten. Bauern, Adelige, Geistliche, Bürger und Knappen trafen sich hier, tauschten Neuigkeiten, Meinungen und Gerüchte aus – manchmal auch hitzig. Die einheimische Bevölkerung trat hier auch mit Reisenden in Kontakt, beim gemeinsamen Essen und Trinken tauschte man sich aus, zu ganz Alltäglichem genauso wie zu aktuellen gesellschaftlichen Themen.
Im Mittelpunkt der Ausstellung steht daher nicht nur die Geschichte der Tiroler Bauernkriege, sondern vor allem das gesellschaftliche Spannungsfeld, in dem sich diese Konflikte entluden.
Die Ausstellung wird im Rahmen des Euregio-Museumsjahres 2025 „Weiter sehen“ veranstaltet.
Hier geht's zum Podcast zur Sonderausstellung:
Das Wirtshaus: Ein Spiegelbild der Gesellschaft - Geschichten aus den Museen | Podcast on Spotify